Nach seinem gefeierten Debüt mit „Der junge Törless“
(1966) und den weiteren Arbeiten „Mord und Totschlag“, „Michael Kohlhaas –
Der Rebell“ und „Baal“ präsentierte der Autorenfilmer Volker
Schlöndorff 1971 mit „Der plötzliche Reichtum der armen Leute von
Kombach“ sein nächstes großes Werk, mit dem er nicht nur seine Kindheit in
Hessen aufarbeiten, sondern sich nach eigenen Worten auch erstmals weiterentwickeln
konnte. Das Drehbuch zu dem Provinzdrama nach einer wahren Begebenheit schrieb Schlöndorff
zusammen mit seiner späteren Ehefrau Margarethe von Trotta.
Inhalt:
Als der Strumpfhändler David Briel (Wolfgang Bächler)
den Männern im Dorf die Idee unterbreitet, den Geldtransport des Landesfürsten,
der monatlich von Gladenbach nach Gießen fährt, zu überfallen, sind die
frommen, aber verarmten Bauern und Tagelöhner schnell dabei. Zusammen mit Hans
Jacob Geiz aus Kombach (Georg Lehn), dessen beiden Söhnen Heinrich (Reinhard
Hauff) und Jacob (Karl Joseph Kramer) sowie Jost Wege, Johannes
Soldan (Harald Müller), Ludwig Acker (Harry Owen) und dem
Landschütz Volk (Karl Heinz Merz) brauchte Briel allerdings einige
Versuche, bis am 19. Mai 1822 der Plan endlich erfolgreich umgesetzt werden konnte
und über 10.000 Gulden erbeutet wurden. Da die Räuber ihre Tat aber nicht
geheim halten können und mit ihrem plötzlichen Reichtum protzen, kann Richter
Danz (Wilhelm Grasshoff) die Täter schnell ermitteln. Ihnen wird
gnadenlos der Prozess gemacht…
Kritik:
Für den in Wiesbaden geborenen Filmemacher Volker
Schlöndorff war es existentiell, die nach einem Gerichtsprotokoll
entwickelte Geschichte in ihrem historischen Kontext zu belassen, statt sie in
die heutige Zeit zu transportieren, um eine Parabel oder ähnliches daraus zu
machen. Die Schwarzweiß-Bilder unterstreichen die triste Atmosphäre eines
Dramas, das durch die sachlichen Schilderungen aus dem Off einen semi-dokumentarischen
Charakter aufweist, der durch die größtenteils amateurhaften Darbietungen der
Schauspieler etwas spröde wirkt. Keinen Zweifel lässt die Milieubeschreibung an
der Verarmung und Unterdrückung der Bauern und Tagelöhner, die nur durch einen
Überfall ihre missliche Situation zu bewältigen glauben, mit dem plötzlichen
Reichtum aber nicht angemessen umgehen können. Auch wenn sich Schlöndorff
vorwiegend mit den kläglich gescheiterten Versuchen des Überfalls befasst und kaum
auf die Einzelschicksale eingeht, gelingt ihm mit der Inszenierung des Falls,
der als „Postraub in der Subach“ in die Kriminalgeschichte einging, ein
atmosphärisch stimmiges Bild der Lebensumstände in der damaligen Zeit zu
zeichnen.


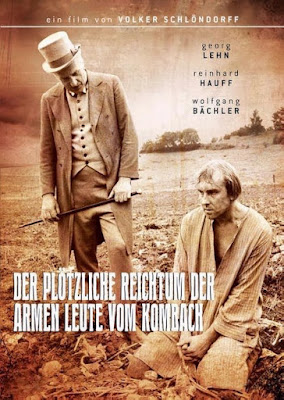







Kommentare
Kommentar veröffentlichen